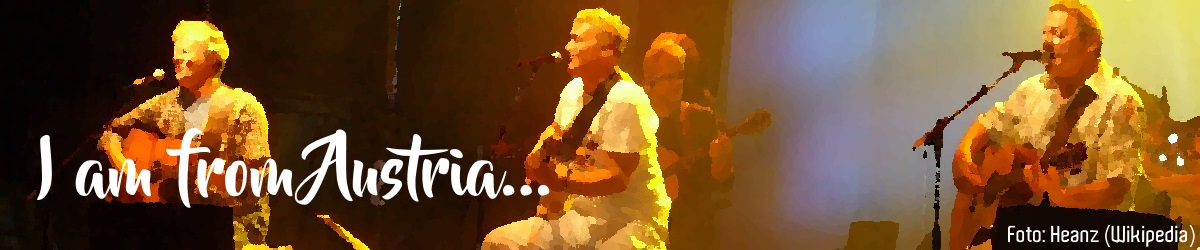ein Weihnachtsnachmittag im Büro, da ist Zeit, einen Konzertbericht zu schreiben. Ich war mir nicht sicher, ob ich überhaupt meine Eindrücke vom „Farewell, Karratsch“-Konzert zusammenfassen soll, aber vielleicht interessiert es den einen oder anderen und ich möchte doch meine Erinnerung an diesen großen Abend wachhalten. Auch wer mit Degenhardt fremdelt: es werden berühmte Namen auftauchen in diesem Text!
Marc und ich trafen uns etwa eine Stunde vor Beginn und waren bei weitem nicht die ersten. Aber wir gehörten zu den Jüngeren. Marc sogar zu den Jüngsten, wenn mir die Bemerkung gestattet ist. Das Theater am Schifferbauerdamm kannte ich bislang nicht von eigener Anschauung, es war mir freilich als Institution ein Begriff, aber ich hatte es mir ein bisschen proletarischer vorgestellt. Kein roter Samt, Putten an den Decken, goldglänzende Balkone und Kronleuchter. Allein dieser eher kuschelige Saal war ein Erlebnis. Erst kurz vor Beginn durfte man rein, bis kurz zuvor war geprobt und am Ton geschraubt worden – kein Teil der Inszenierung, man weiß ja nie, dieser dubiose V-Effekt
Der Saal war voll, das Konzert innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft. Dass der Vorverkauf genau am Tag nach Degenhardts Tod begann war Zufall, hat den Verkauf aber bestimmt beschleunigt. Im Foyer gab es zusätzliche Sitzplätze, das Konzert wurde auf eine Leinwand übertragen. Wir hatten noch einen guten Parkettplatz erobert, wobei sich „gut“ auf die Sicht zur Bühne bezieht, nicht auf die Sitzqualität, die hat „romantisches Glotzen“, was Brecht sich ja verbeten hatte, verhindert, zumindest für Menschen über eins-achtzig.
Eigentlich sollte es ein Konzert zum 80. Geburtstag von Franz Josef Degenhardt werden, der soll aber – so erzählten es die Moderatoren – auf die Idee zu einer solchen Veranstaltung angesprochen, gesagt haben: „Zu meinem 80. – da machen wir gar nichts“. Etwas später soll ihm die Idee aber doch ganz gut gefallen haben, auch wenn er selbst gesundheitlich schon lange nicht mehr in der Lage war, aufzutreten. Nun ist es also ein Gedenkkonzert geworden, am Programm wurde aber nichts geändert und das war auch richtig so. So wurde es keine Trauerveranstaltung sondern eine – bis auf den Schluss – unsentimentale Feier seines Werks. Die Moderatoren Konstantin Wecker und Prinz Chaos II. führten unaufgeregt und bescheiden durch den Abend, verzichteten im zweiten Teil streckenweise ganz auf Zwischenmoderationen.
Es begann mit Max Prosa, den ich nicht kannte und der auch erst im Januar seine erste Platte veröffentlicht. Aber er ist im Vorprogramm von Clueso aufgetreten und das ist ja keine schlechte Referenz. Gerade 22 Jahre alt und damit nicht mal halb so alt wie das Lied, das er sang: „Gelobtes Land“. Ein sehr stimmungsvoller Beginn und schön, dass am Anfang des Abends kein Hit steht. Aber er bringt es schnoddrig, swingend und sympathisch rüber. Genauso wie sein eigenes Lied „Abgründe der Stadt“. Nach ihm begrüßte Konstanton Wecker erst mal einen berühmten Gast: Gisela May war im Publikum, was alle sehr freute. Allerdings holte die alte Dame zu allerlei Geschichten aus, was ein wenig befremdlich wirkte. Außerdem beschwerte sie sich, nicht als Sängerin eingeladen worden zu sein. Nun denn, sie sang dann doch noch eine Brecht-Strophe. Weitere Gäste im Saal wurden wohlweislich nicht begrüßt. Schade eigentlich, Heike Makatsch soll da gewesen sein, vielleicht hätte sie ja spontan „Stand by your man“ gebracht.
Barbara Thalheim kam mit einem weiteren Lied, dass ich an dem Abend nicht erwartet hatte: „Unser Land“. Aber das brachte sie so schön kämpferisch und verletzlich zugleich, dass es eine Freude war. Auch ihr eigenes Lied über die Zeiten der Stagnation hat mir gefallen. Klar, da ist auch das drin, was man Ostalgie nennt, auch ein bisschen Larmoyanz, aber sehnen wir uns nicht alle eigentlich nach Stagnation? Wenn man nur wüsste, wann der beste Zeitpunkt zum Stagnieren ist, leider weiß man’s erst hinterher. Sie beklagte, dass kein Politiker zur Beerdigung von Christa Wolf erschienen ist – zurecht, aber ist die Kulturlosigkeit unserer herrschenden Klasse nicht schon bekannt? Dass kein Politiker sich zu Degenhardts Tod geäußert hat jedenfalls sollte als Auszeichnung verstanden werden.
Wiglaf Droste bekommt sicherlich auch keine Kränze geflochten, wenn er mal abtritt. Ich kannte ihn bisher nur als ultra-bösen Kolumnisten, als Liedermacher war er mir unbekannt. Er sang „Wölfe mitten im Mai“ , war ziemlich nervös und las den Text vom Blatt ab, was ich bei diesem Werk aber gut verstehe. Da ist sogar der alte Degenhardt böse gestolpert, als ich ihn das letzte mal sah. Es wirkte trotzdem eindrucksvoll und bedrückend, wer denkt heute bei diesem Lied nicht an den „nationalsozialistischen Untergrund“ und seine Freunde beim Verfassungsschutz. Lockerer war Droste bei seinem eigenen Lied, das wohl nicht zuletzt wegen der Spitze gegen Wolf Biermann gut ankam.
Götz Widmann hatte ein bisschen mehr Schwierigkeiten mit seinem „Proletarier sucht Frau“, dieser Humor war manchem grauen Degenhardt- Hörer doch etwas fremd. Dafür hatte Widmann mit seiner Interpretation eines Degenhardt-Liedes voll ins Schwarze getroffen. Ja, man kann bei Degenhardt richtig lachen – der „Deutsche Sonntag“ beweist es, und wie Götz Widmann ihn bringt, erst recht.
Dann kam Dota und bei der bin ich befangen. Ich finde sie großartig und sie war es an dem Abend auch. Sie sang „Ein schönes Lied“ von Degenhardt, als hätte er es für sie geschrieben und das eigene „Utopie“ passte auch so wunderbar in den Abend – das gefiel auch den Grauhaarigen. „Ich habe viel zuviel Ärger und viel zuwenig Wut“ – toller Text. Degenhardt hätte vielleicht gesagt, Mädchen, an dem „zuwenig Wut“ kann man was machen. Er hätte vielleicht auch einen undifferenzierten Klassenstandpunkt bemängelt aber er hätte auch gewusst, da ist jemand, der das Grundproblem der Gesellschaft, in der wir es aushalten müssen, erkannt hat – und außerdem richtig gute Musik macht.
Goetz Steeger war der nächste, der Produzent der letzten beiden Degenhardt-Alben, der auch selbst Liedermacher ist und dessen „Fenster“ mich sehr gespannt gemacht hat auf sein Album. Von Degenhardt sang er „Die Ernte droht“, dessen Szenario uns durch die diversen Finanzkrisen noch näher rückt. Er erzählte ein bisschen von den letzten Produktionen bei Degenhardt zuhause: „Die Frühstücke wurden immer länger und die Sessions immer kürzer“. Warum auch nicht, die Aufnahmen waren alles One-Take-Aufnahmen, er war halt saucool bis zum Schluss. Arrangiert wurden die Lieder Degenhardts seit zwanzig Jahren von seinem Sohn Kai, selbst ein sehr guter Liedermacher. Er brachte von seinem Vater „Ich ging im letzten Mai“ – noch mal was Kämpferisches - und den eigenen „Tag im Mai“, der mir zwar auf der CD besser gefällt (wegen der Frauenstimme), der aber einen schönen Abschluss des ersten Teils bildete, gerade im Zusammenhang mit dem Lied davor:
Und wird die Welt und all die Pein
Sich nie mehr wenden - das kann sein -
Doch Januartage zieh’n vorbei
Und kommen and’re - auch im Mai
Der Teil nach der Pause begann mit einer Lesung: Carmen-Maja Antoni, Schauspielerin am Berliner Ensemble und auch aus dem Fernsehen bekannt, las aus „Zündschnüre“, Degenhardts erstem Roman über eine proletarische Kinderbande im zweiten Weltkrieg. Und sie las das so großartig, die Kraft Degenhardtscher Prosa ist mir bis dahin nicht so bewusst gewesen. Schön, dass ich das so hören durfte.
Frank Viehweg war mir bislang nicht bekannt, aber er wird mir nicht unbekannt bleiben, CDs werden bestellt. Als einziger sang er kein Degenhardt-Original, sondern einen eigenen Text auf eine Degenhardt-Melodie. Er hatte nach der „Wende“ seine Fragen und Sorgen auf „Kommt an den Tisch unter Pflaumebäumen“ formuliert, jenes Lied mit dem heute so anachronistischen Refrain „Unsere Sache, die steht nicht schlecht“. In seinem eigenen Liedbeitrag ging es um die Fremdheit in dem Land „Da, wo ich lebe“.
Joana war Anfang der siebziger Jahre wohl die einzige Frau, die im Liedermacherbusiness groß war. Nach einem Bühnenunfall im vergangenen Jahr kann sie noch nicht wieder Gitarre spielen und wurde von einem Pianisten begleitet. Zunächst bei einem ihrer bekanntesten eigenen Lieder: „Und mit dir wollt ich mal nach Gretna Green“ und dann bei „Kirschenzeit“, Degenhardts Übertragung von „Les temps des cerises“, ihre schöne Altstimme tat dem Lied gut.
Es folgte Daniel Kahn aus Detroit, der offen zugab, Degenhardt bis vor kurzem nicht gekannt zu haben. Er brachte ordentlich Leben in die Bude. Zunächst mit einer zur Ukulele gesungenen jiddisch-englischen Version von „Die alten Lieder“, dann mit dem eigenen „The good old bad old days“. Damit war jegliche Ostalgie oder Nostalgie weggewischt. Ein Hammerstück – Liedermaching goes Klezmer mit einem Einschlag Russendisko.
Die beiden Moderatoren des Abend brachten dann ihre musikalischen Beiträge. Mit Prinz Chaos II. kann ich nicht so richtig viel anfangen. Sein „Edelweißpirat Nevada-Kid“ war zwar recht munter, aber ein bisschen affektiert. Und sein eigenes Stück über Berlin war zwar recht fetzig, ich hab’s aber nicht verstanden. Konstantin Wecker brachte von Degenhardt „Weiter im Text“ – allerdings mit Erlaubnis des Meisters mit einer eigenen Melodie („Ich sag das weil hier so viele Rechtsanwälte sind, die auch noch Degenhardt heißen“). Das war meiner Meinung nach überflüssig, die Melodie von Degenhardt ist schön genug und die neue klang mir zu weckerig. Sein eigenes „Empört euch“ rief aber auch meine Begeisterung hervor. Da war sie wieder, die politische Wut, die hat der Bayer Wecker viel ungefilterter drauf als der Westfale Degenhardt – aus dem Bauch halt, nicht so sehr aus dem Kopf, ganz bestimmt ein Höhepunkt des Abends.
Als ruhiger Gegensatz dazu eine weitere Lesung, diesmal von Veit Schubert aus dem letzten Degenhardt-Roman „Für ewig und drei Tage“, einer Familiensaga. Auch das ein tolles Erlebnis. Ich fand es schön, dass auch die Romane Degenhardts an diesem Abend Erwähnung fanden und dann noch durch zwei so großartige Vortragskünstler, das war schon was.
Wenn’s bis jetzt nicht sentimental war, dann wurde das jetzt anders. Jan Degenhardt kam, ältester Sohn von Franz Josef und wie sein Bruder Rechtsanwalt. Und wie sein Bruder kann er den Vater nicht verleugnen, nicht zuletzt in der Sprache. Er sang „Fuchs auf der Flucht“ – ein Lied über eine Beerdigung und erzählte dann von den letzten Tagen des Vaters. Wie der sich einmal in seinem Pflegebett aufgebäumt hat und rief: „Schluss mit der Charade! Wir hauen ab!“. „Papa, du liegst im Sterben. Aber wir sind alle da.“ „Sterben? Mehr fällt dir dazu nicht ein?“. Jan sang dann „Mantel aus Brokat“ – ob das ein Lied über den Vater ist, ich weiß es nicht, es ist verschwommen, assoziativ, aber es ist sehr berührend.
Zum Schluss kam Hannes Wader. Der musste ein bisschen warten, bis sein Teleprompter installiert war und sang dann „Reiter wieder an der schwarzen Mauer“ – etwas aufgepeppt aber vielleicht ein bisschen zu routiniert. Schließlich „Alter Freund“, ein Lied über den Kirschbaum in Degenhardts Garten, der vor einiger Zeit gefällt werden musste und über den Wunsch, dereinst im Schatten des neuen Baumes zusammen zu sitzen. Das wird nicht mehr passieren. Gerade deshalb ein guter Schlusspunkt in diesem Konzert, in dem das allerletzte Wort aber der Verstorbene hatte: Saal- und Bühnenlicht gehen aus, nur das Degenhardt-Bild auf der Bühne wird angestrahlt, alle Künstler des Abends kommen auf die Bühne und vom Band ertönt „An der Quelle“ von Degenhardts letztem Album:
„Irgendbald müssen wir weichen, rieselt schon das Stundenglas?
Hoffentlich wird dann noch reichen der Champagner und das Gras.
Ist die Feier dann zuende und sie kommt schließlich zu mir,
jene endgültige Wende, öffne ich die schwarze Tür.“
Ich hätte nicht gedacht das mir das so nahe geht, aber das tut’s sogar jetzt noch in der Erinnerung. Am Ende erhebt sich der Saal, die Künstler umarmen sich und verneigen sich mit dem Rücken zum Publikum, die Ehre gilt einem anderen. Um kurz vor zwölf war Schluss, nach fast vier Stunden. Ein würdiger Abend, eine großartige Feier eines großartigen Werkes.
Herzlichen Dank, Marc, dass Du mit dabei warst!
(oh je, das ist ja viel zu lang geworden)
Michael